Japanische Trostfrauen konnten nicht glauben, dass amerikanische Soldaten sie nie berührt hatten.H
15. August 1945. Japan hat gerade kapituliert. Doch in einer kleinen Bambushütte auf den Philippinen ist die Angst noch immer allgegenwärtig. Junge Frauen, die als sogenannte Trostmädchen gezwungen wurden, sitzen schweigend da und warten auf das, was ihrer Meinung nach als Nächstes kommen wird. Sie erwarten dieselbe Grausamkeit, die sie jahrelang erdulden mussten.
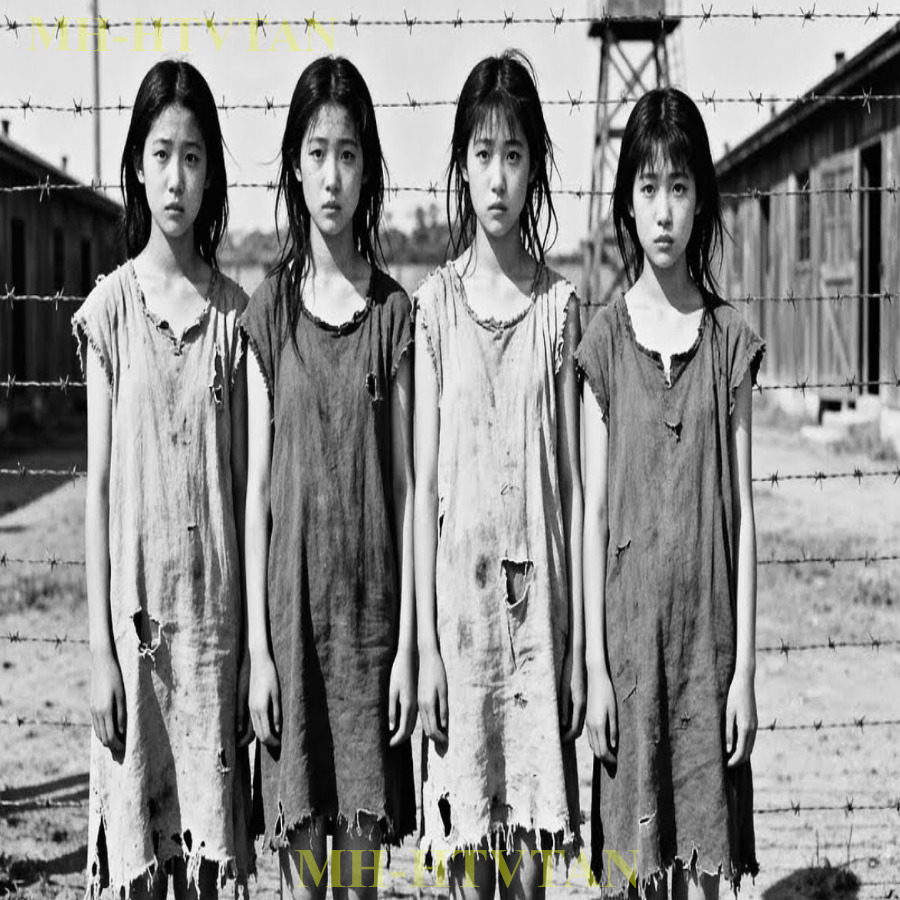
Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Amerikanische Soldaten betreten den Raum – nicht mit Drohungen, nicht mit Befehlen, sondern mit Essen, Seife, sogar Musik. Die Frauen sind fassungslos. Zum ersten Mal wagt es niemand, sie anzufassen.
Am Nachmittag des 15. August 1945 hallte die Stimme Kaiser Hiitos durch die Radiowellen, gefiltert durch das Rauschen, und verkündete die Kapitulation in einer so förmlichen Sprache, dass viele ihre Bedeutung zunächst nicht erfassen konnten. In Tokio weinten einige, andere rebellierten. Doch Hunderte von Kilometern entfernt, in den stickigen Hütten von Luzon, bedeuteten die Worte den jungen Frauen, die auf Schilfmatten saßen und die schwüle Luft mit Fächern bekämpften, wenig. Für sie war der Krieg noch nicht vorbei.
Die Wachen kamen weiterhin, die Türen schlossen sich weiterhin, und die Angst vor Schritten bestimmte weiterhin ihren Alltag. Der Widerspruch war grausam. Jahrelang bedeuteten Uniformen Besitz, Befehle und die Gewissheit, berührt zu werden, ob sie es wollten oder nicht. Das System, das sie gefangen hielt, war gleichermaßen gewaltig und banal.
Von Burma bis Shanghai erstreckten sich sogenannte Troststationen, in denen Frauen arbeiteten, denen man vorgaukelte, sie dienten einem Imperium, während sie in Wahrheit Gefangene seines Systems waren. Die Zahlen variieren, doch selbst vorsichtige Historiker schätzen, dass zwischen 50.000 und 200.000 Frauen dieses Netzwerk durchliefen. Viele waren Koreanerinnen. Ein alliierter Bericht aus dem Jahr 1944 sprach von 80 bis 90 Prozent, obwohl auch Chinesinnen, Philippinerinnen, Indonesierinnen, Taiwanesinnen und Niederländerinnen zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Sie wurden wie Inventar in Büchern erfasst.
Einige wurden in Kasernen am Stadtrand von Manila untergebracht, andere in provisorischen Hütten im Dschungel Burmas. Ein japanischer Armeearzt beschrieb das System einmal in erschreckend bürokratischen Worten. Frauen wurden untersucht, erfasst und regelmäßig ausgetauscht, um die Quoten zu erfüllen.
Überlebende erinnerten sich später an die wöchentlichen Kontrolluntersuchungen, bei denen die Demütigung nicht nur von den ärztlichen Untersuchungen, sondern auch von den anschließenden Strichlisten ausging. Eine Frau, an die man sich Jahrzehnte später erinnerte, sagte schlicht: „Wir waren keine Menschen. Wir waren Termine.“ Die Sinneseindrücke dieser Orte waren unvergesslich. Der stechende Geruch von Desinfektionsmittel vermischte sich mit Schweiß. Das Klappern von Dosen vor den Bambuswänden. Der schwache Duft von Weihrauch, den manche Frauen anzündeten, um die Angst zu überdecken. Die Nächte waren am schlimmsten.
Das Summen der Insekten draußen bildete einen starken Kontrast zum holprigen Rhythmus der Stiefel auf dem Kies und kündigte einen weiteren Eintritt, eine weitere Runde an. Manche Frauen sahen sich an einem einzigen Tag 15 bis 30 Männern gegenüber. Dies geht aus späteren Zeugenaussagen hervor, die von US-amerikanischen Sanitätern und internationalen Kommissionen gesammelt wurden.
Der Kontrast zwischen der hochtrabenden Kapitulation des Kaisers und der harten Realität in diesen Räumen hätte nicht größer sein können. Doch schon vor der Kapitulation zeigten sich Risse im System. Die Vorräte wurden knapp. Verzweifelte und hungrige Soldaten teilten ihre Reisrationen mitunter mit den Frauen, nicht aus Mitleid, sondern aus Erschöpfung. In jenen letzten Monaten deuten Tagebücher auf einen seltsamen Zusammenbruch der Formalitäten hin.
Japanische Wachen waren zu erschöpft, um für Ordnung zu sorgen. Frauen klammerten sich in geflüsterten Liedern an einen Funken Menschlichkeit. Die koreanische Überlebende Kim Haksun, die Jahrzehnte später, 1991, öffentlich darüber sprach, erinnerte sich: „In den letzten Kriegstagen fürchteten die Soldaten die Niederlage, aber wir hatten keinen Zufluchtsort. Wir waren gefangen in ihrer und unserer eigenen Angst.“
Die Statistiken zeichneten ein umfassenderes Bild. Bis Sommer 1945 hatte die kaiserliche Armee in mindestens zehn Gebieten sogenannte Troststationen eingerichtet. Allein in Manila gab es Dutzende davon, die Tausende von Soldaten versorgten. Aus später von den Alliierten beschlagnahmten medizinischen Unterlagen ging hervor, dass über 70 % der Frauen unterernährt waren, mehr als die Hälfte an Geschlechtskrankheiten litt und fast alle dauerhafte Narben, sowohl physische als auch psychische, davontrugen.
Diese jahrelang in Archiven verborgenen Zahlen enthüllten die wahren Kosten des Systems. Die Illusion der Kontrolle durch die Armee, bezahlt mit dem Leid einer ganzen Generation. Und doch, im August 1945, kam die Maschinerie plötzlich zum Stillstand. Befehle aus Tokio verloren ihre Gültigkeit.
Die Wachen, die diese Hütten bewacht hatten, lauschten dem Radio. Ihre Gesichter waren ausdruckslos, ihre Autorität verflüchtigte sich im Rauschen. Draußen näherten sich alliierte Konvois, ihre Dieselabgase vermischten sich mit der feuchten Luft. Die Frauen drinnen wussten noch nicht, was sie erwartete. Sie wussten nur, dass sich etwas ändern würde, und mit der Veränderung kam der Schrecken. Was für Männer würden kommen? Würden sie brutaler sein als die vorherigen? Das Geräusch neuer Stiefel auf Kies brachte Stille.
Die Papierschirme zitterten. Dann, anstelle von Befehlen, hörte man das Knarren herabgelassener Kisten, das Zischen einer Mundharmonika, das metallische Ploppen einer geöffneten Dose. Der Widerspruch vertiefte sich. Der Krieg war vorbei. Doch für die Frauen im Inneren war der größte Schock nicht die Niederlage, sondern das plötzliche Ausbleiben jener Gewalt, die sie erwartet hatten. Aber das war erst der Anfang.
Das Paradoxon der Befreiung lässt sich nicht verstehen, ohne zunächst die Mechanismen zu analysieren, die diese Frauen überhaupt erst in diese Lage gebracht hatten. Das japanische Militär geriet nicht zufällig in dieses System der sexuellen Nötigung. Es war geplant, kalkuliert und mit kalter Präzision ausgebaut worden. Seine Ursprünge reichen bis in die 1930er Jahre zurück. Nach dem brutalen Massaker von Nanjing 1937, als Berichte über massenhafte sexuelle Gewalt selbst Japans Verbündete schockierten, versuchte das kaiserliche Oberkommando, die Impulse der Soldaten zu kontrollieren. Ihre Lösung bestand nicht darin, den Missbrauch zu beenden, sondern ihn zu organisieren.
Als Euphemismus wurde „Eanjo“ (Troststation) gewählt. Bis zur Ausweitung des Pazifikkrieges 1941 waren diese Stationen für die japanische Armee ebenso unverzichtbar geworden wie Nachschubdepots oder Feldlazarette. Frauen wurden über die Grenzen transportiert, als wären sie Munition.
Koreanischen Teenagern wurde versprochen, sie würden in Fabriken oder Krankenhäusern arbeiten, nur um dann in Züge und Schiffe nach Südostasien verfrachtet zu werden. Philippinische Mädchen wurden bei Überfällen auf Dörfer verschleppt. In Niederländisch-Ostindien wurden Kolonialfamilien auseinandergerissen und ihre Töchter als Kriegsbeute verschleppt. Bis 1942 gab es Stationen in Shanghai, Nanjing, Singapur, Burma, den Philippinen und sogar auf den Pazifikinseln. Geschäftsbücher sind nur fragmentarisch erhalten.
Sie wiesen Quoten, Rotationen und Zahlungen aus, die den Frauen selbst so gut wie nie zugutekamen. Historiker schätzen, dass in der Blütezeit des Systems bis zu 400 Stationen gleichzeitig in Betrieb waren. Bei durchschnittlich 20 Frauen pro Station war das Ausmaß enorm. Dennoch reduzierten offizielle Dokumente dieses riesige Netzwerk oft auf bloße Zahlenkolonnen: 23 Frauen, 300 Kunden pro Tag, wöchentliche medizinische Untersuchung.
Die Grausamkeit lag im Gegensatz. Öffentlich inszenierte sich Japan unter dem Motto „Asien den Asiaten“ als Hüter der asiatischen Einheit. Insgeheim aber ernährten sich seine Armeen von systematischer Ausbeutung. Der Widerspruch war offensichtlich. Den Soldaten wurde erzählt, sie würden ihre asiatischen Schwestern vor westlicher Herrschaft schützen, während ebendiese Schwestern in Hütten eingesperrt und wie verbrauchbare Ressourcen behandelt wurden. „Sie sprachen von Ehre“, erinnerte sich eine chinesische Überlebende Jahrzehnte später.
Doch sie nährten ihre Ehre von unseren Körpern. Statistiken belegen dies. Ein alliierter Geheimdienstbericht aus dem Jahr 1944, der auf erbeuteten Dokumenten basierte, legte nahe, dass bis zu 90 % der Trostfrauen Koreanerinnen waren. Andere Studien bezifferten die Gesamtzahl der ausgebeuteten Frauen auf 50.000 bis 200.000 – eine Spanne, die die gezielte Vernichtung von Aufzeichnungen durch die sich zurückziehenden japanischen Truppen widerspiegelt.
Selbst die niedrigsten Zahlen übertreffen die Einwohnerzahl ganzer Städte während des Krieges bei Weitem. Fragmentarische Schilderungen aus Zeugenaussagen verdeutlichten das Bild. Überlebende erinnerten sich an den erstickenden Geruch des Desinfektionsmittels, das zwischen den Kontrollgängen versprüht wurde, an den Geschmack von verdünntem Reismehl, an das Kratzen rauer Decken in schlecht belüfteten Hütten.
Manche beschrieben die drückende Stille nach den täglichen Terminen, die nur vom Husten der Wachen oder dem Gekritzel der Stifte in den Notizbüchern unterbrochen wurde. Für Außenstehende waren dies Ruhepausen. Für die Eingeschlossenen waren es Gefängnisse ohne Schlösser, aus denen es kein Entrinnen gab, da der gesamte Kontinent an dieselbe Maschine angeschlossen war. Gelegentlich flammte Widerstand auf.
Frauen täuschten Krankheit vor, tauschten im Flüsterton Strategien aus, um die Kontrollen zu verzögern, oder ritzten kleine Zeichen in Holzwände, um die Tage zu zählen. Doch jeder Akt des Widerstands barg das Risiko von Schlägen oder Schlimmerem. In einer Zeugenaussage wurde von einem 16-jährigen Mädchen berichtet, das während eines Transports in Burma zu fliehen versuchte. Man brachte sie zurück, und danach sprach niemand mehr ihren Namen aus.
Bis 1945 wurden Knappheit und Erschöpfung im System ignoriert. Seife und Medikamente wurden knapp, die Lebensmittelrationen schrumpften und die versprochenen Kontrollen wurden vernachlässigt. Krankheiten breiteten sich ungehindert aus. In Manila enthüllten erbeutete japanische Dokumente, dass mehr als die Hälfte der Frauen mit Geschlechtskrankheiten infiziert waren und bis zu 70 % Anzeichen von Mangelernährung aufwiesen.
Das System brach zusammen, nicht aus Mitleid, sondern aufgrund logistischer Erschöpfung. In dieses zerfallende System würden bald amerikanische Soldaten eingreifen. Sie trugen Kisten, Zigarren, Retas und Funkgeräte und erwarteten, Feinde oder Kollaborateure anzutreffen. Stattdessen fanden sie junge Frauen, die in Bambushütten kauerten, reduziert auf Nummern in Notizbüchern. Für die Frauen sollte sich das Paradoxon bald erneut wenden.
Dieselbe Militärkultur, die sie gelehrt hatte, mit Übergriffen zu rechnen, löste sich plötzlich auf und wurde durch eine Besatzungsmacht ersetzt, die sie zu ihrem Erstaunen nicht einmal berührte. Was sie als Nächstes sahen, widersprach jeder Regel, an die sie geglaubt hatten. Für die Frauen in den Bahnhöfen war das Leben schon lange vor der Kapitulation auf bloße Aufzeichnungen reduziert worden.
Sie wurden nicht als Töchter oder Schwestern gezählt, sondern als Einträge in Notizbüchern. Die japanische Armeebürokratie verwandelte Intimität in Arithmetik, und jeder Eintrag markierte den Verlust eines weiteren Stücks Menschlichkeit. Ein erhaltenes Register aus Burma enthielt nur Zahlen: Frauen 14 Besuche pro Tag, 280. Hochgerechnet bedeutete das durchschnittlich 20 Männer pro Frau und Tag.
Später befragten Sanitäter Überlebende, die ähnliche Zahlen schilderten: 15 bis 30 Besuche täglich, ohne jegliche Erholung außer Krankheit, die selbst Bestrafung nach sich ziehen konnte. „Wir waren keine Menschen, wir waren Schichten“, erinnerte sich eine koreanische Überlebende Jahrzehnte später. „Ihre Worte brachten den Widerspruch auf den Punkt.“ Die Armee nannte diese Frauen Trost, doch ihr eigener Trost war ihnen völlig genommen worden.
Die sinnlichen Details sind in den Aufzeichnungen allgegenwärtig. Frauen berichteten vom Geruch der Karbolsäure, die bei den wöchentlichen Inspektionen ihre Haut verätzte, vom Rascheln der Papierschirme, die sich nie richtig schlossen, um Privatsphäre zu gewährleisten, und von den kratzigen Autouniformen, die an ihnen vorbeistrichen wie ein Zeichen der Unausweichlichkeit.
Ein niederländischer Gefangener berichtete später den Ermittlern, das Geräusch von Stiefeln sei schlimmer gewesen als jeder Schusswechsel. Es bedeutete, dass die Nacht von Neuem begann. Drinnen waren die Erinnerungen an ihr früheres Leben zerbrechlich, wie Talismane festgehalten. Eine philippinische Überlebende erzählte, wie sie Volkslieder auf Tagalog summte, während sie darauf wartete, dass die Soldaten abzogen, in der Hoffnung, sich daran zu erinnern, dass sie noch irgendwo dazugehörte. Ein 17-jähriges koreanisches Mädchen schnitzte einen Vogel in den Holzrahmen ihrer Matte, ein Symbol der Flucht an einem Ort, an dem es kein Entrinnen gab.
Diese kleinen Akte des Gedenkens waren an sich schon paradox, Momente der Menschlichkeit, die in einem System am Leben erhalten blieben, das darauf ausgelegt war, sie auszulöschen. Die Bürokratie verschlimmerte die Situation noch. Frauen erhielten Marken wie Verkäuferinnen, und jeder Soldat übergab ihnen eine, bevor er an der Reihe war. Manche Stationen bewahrten sogar Quittungen auf. Soldaten erhielten abgestempelte Ausweise, die ihren Besuch bestätigten – eine groteske Farce der Höflichkeit, die sich über einen systemischen Missbrauch legte. Die japanischen Offiziere, die diese Baracken beaufsichtigten, berichteten in nüchterner, klinischer Sprache über deren Effizienz.
Ein Dokument beschrieb, wie Frauen alle zwei Monate ausgetauscht werden konnten, um die Moral aufrechtzuerhalten. Die beiläufige Grausamkeit der Formulierung ließ keinen Raum für die Schreie, die sie verbarg. Die Zahlen verdeutlichen das kalte Ausmaß. Schätzungsweise 400 solcher Bordelle waren 1943 in ganz Asien in Betrieb.
Wenn in jedem dieser Lager 20 Frauen untergebracht waren, bedeutete das, dass sich dort jederzeit etwa 8.000 Frauen aufhielten. Im Laufe der Kriegsjahre und der Verlegungen stieg die Zahl auf Zehntausende. Überlebende berichteten später, dass einige Mädchen erst 12 Jahre alt waren und ihre Körper den Anforderungen des Systems noch nicht gewachsen waren. Medizinische Unterlagen, die US-amerikanische Armeeeinheiten nach der Befreiung auf den Philippinen fanden, wiesen Geschlechtskrankheitenraten von über 50 % und Hinweise auf erzwungene Abtreibungen ohne Betäubung auf.
Doch inmitten dieser brutalen Logik traten Paradoxien des Überlebens zutage. Manche Frauen berichteten von Wachen, die ihnen heimlich zusätzliche Reisbällchen zusteckten, nicht aus Güte, sondern weil sie durch Krankheiten weniger nützlich waren. Andere erinnerten sich an flüchtige Bündnisse; ein Mädchen lenkte einen Soldaten ab, damit ihre Freundin sich eine Stunde ausruhen konnte. Solche Improvisationen waren zum Überleben notwendig, doch jede einzelne dieser Handlungen wurde vom Ausbeutungssystem wieder verschlungen.
Als am 15. August 1945 die Stimme des Kaisers aus dem Radio ertönte, schlossen die Wachen nicht. Tagelang verrichteten sie ihre Routine, im Ungewissen über die Befehle. Die Frauen, aus Angst zum Gehorsam erzogen, schwiegen. Das Geräusch von Stiefeln hallte noch immer durch die Nacht, doch nun trugen diese Stiefel Zögern in sich.
Doch in der Ferne näherten sich neue Motoren. Lauter, schwerer, ungewohnt. Amerikanische Konvois rollten durch die Außenbezirke Manilas, und mit ihnen einher ging ein anderes Paradoxon: Soldaten, die Lebensmittelkisten statt Kassenbücher mitführten und ihre Anwesenheit nicht an ausgetauschten Zeichen, sondern an angebotenen Geschenken maßen.
Für die Frauen, die durch Bambuswände starrten und warteten, wurde Ungläubigkeit zur neuen Form der Angst. Sie hatten sich auf das Bekannte gefasst gemacht und stießen stattdessen auf das Unvorstellbare. Die ersten Anzeichen der Befreiung waren nicht Worte, sondern Gerüche und Geräusche. Dieselabgase amerikanischer Lastwagen drangen in die Lager ein und vermischten sich mit der feuchten, muffigen Luft zwischen den Bambuswänden.
Statt der scharfen Befehle der Japaner hörten die Frauen ungewohnte Geräusche wie Ziehen und Lachen, das Klappern von Metallkisten, die auf Kies abgestellt wurden. Für Frauen, die daran gewöhnt waren, bei jedem Schritt zusammenzuzucken, war die Stille unerträglich. Sie erwarteten, dass der Alltag bald wieder von vorne beginnen würde: Befehle, Kontrollen, die unvermeidliche Berührung.
Doch was durch die Papiersiebe drang, war keine Forderung, sondern das metallische Ploppgeräusch einer geöffneten Konservendose. Zeugen beschrieben den Moment später fassungslos. Eine Koreanerin erinnerte sich: „Sie stellten Essen hin, richtiges Essen, und traten zurück. Wir verstanden es nicht. Wir dachten, es sei ein Trick.“ Die Soldaten boten Seife, Zigaretten, sogar eine Mundharmonika an. Eine philippinische Überlebende erinnerte sich an den süßen, klebrigen Geschmack von Dosenpfirsichen, der ihr so fremd war, dass sie beim Essen weinte. Der Widerspruch war erschütternd.
Uniformen füllten noch immer die Türrahmen, doch zum ersten Mal griff niemand danach. Einige amerikanische Soldaten versuchten zu sprechen. Da nur wenige eine gemeinsame Sprache sprachen, genügten Gesten. Eine Tafel Schokolade wurde ausgepackt, eine Zigarette angezündet und mit einem gequälten Lächeln überreicht, ein Mundharmonikaton hallte in der schwülen Luft wider. Jede dieser kleinen Gesten wog mehr als jede Kapitulationserklärung.
Ein Mann lehnte sein Gewehr an die Wand und spielte Musik, erinnerte sich ein niederländischer Gefangener, und uns wurde klar, dass er uns nicht anfassen würde. Dieser Klang bedeutete Freiheit. Der Kontrast hätte nicht größer sein können. Jahrelang hatten die Bordelle als Gefängnisse ohne Schlösser gedient, wo Frauenkörper Nacht für Nacht im Namen der Disziplin beansprucht wurden. Nun entschieden sich plötzlich ebendiese Männer, die dieselbe Macht hätten ausüben können, für Zurückhaltung. Der Schock war körperlich.
Manche Frauen wichen zurück, überzeugt, Gewalt würde folgen, wenn sie reagierten. Vorsicht vor dem Essen. Andere erstarrten, unfähig sich vorzustellen, dass man ihnen die Berührung verweigern könnte. „Wir dachten, sie würden warten“, sagte eine Überlebende, „warten darauf, Freundlichkeit zu zeigen und sich dann zu nehmen, was sie wollten, aber das taten sie nie.“
Die Statistiken der medizinischen Teams der US-Armee verdeutlichten das Ausmaß des Geschehens. In Manila wurde berichtet, dass mehr als die Hälfte der befreiten Frauen an Geschlechtskrankheiten litten und über 70 % Anzeichen von Mangelernährung aufwiesen. Viele waren zu schwach, um zu stehen, als die Soldaten eintrafen.
Die Militärärzte notierten, dass einige weniger als 36 Kilogramm wogen, ihre Rippen deutlich hervortraten und ihre Haut durch jahrelange Entbehrungen hauchdünn war. Für die Sanitäter war dies ein Beweis für systematische Ausbeutung. Für die Frauen war der erste Bissen von Dosenpfirsichen oder einem Löffel Kondensmilch fast unerträglich. „Es war zu süß“, sagte eine später. „Wir waren Süßes gar nicht mehr gewohnt.“
Die sinnlichen Eindrücke der Befreiung blieben ihnen in Erinnerung. Das scharfe Gefühl der Seife auf der nach Jahren ohne sie wundgeschrubbten Haut, der schwere Stoff amerikanischer Lebensmittelsäcke, die nun als Decken dienten, der ungewohnte Klang englischer Wörter in Räumen, die zuvor nur japanische Befehle gekannt hatten. Ein koreanisches Mädchen erinnerte sich später: „Als ich mich das erste Mal mit richtiger Seife wusch, weinte ich.“
Mein Körper erinnerte sich an das Gefühl von Reinheit. Vertrauen jedoch war schwer zu gewinnen. Traumata hatten sie darauf vorbereitet, Verrat zu erwarten. Selbst als Tage ohne Übergriffe vergingen, weigerten sich viele Frauen zu schlafen und warteten auf den unvermeidlichen Rückschlag. Amerikanische Soldaten, die auf das Ausmaß des Misstrauens nicht vorbereitet waren, hinterließen oft Geschenke vor der Tür und zogen sich zurück, ohne zu ahnen, dass gerade diese Geste – die Frauen allein und unberührt zu lassen – das größte Geschenk von allen war.
Das Paradoxon der Zurückhaltung wurde zu einer Art Schock. In einer Welt, in der Uniformen stets Besitz bedeutet hatten, war die Verweigerung der Berührung revolutionär. Und doch begann diese Revolution nicht mit Reden, sondern mit Seife, Pfirsichen und einer Mundharmonika in einer Bambushütte, während der Krieg in Stille versank.
Doch hinter diesen einfachen Geschenken verbarg sich eine weitere Ebene der Geschichte: die Krankenakten, Interviews und Statistiken, die das Leid in Zahlen zu messen suchten, obwohl keine Zahl das Gewicht der geraubten Jahre erfassen konnte. Die Lebensmittelkisten und die Mundharmonika-Lieder erzählten die eine Geschichte, die Akten und Berichte eine andere.
Für die US-Armee war die Befreiung der Frauen aus den japanischen Bordellen nicht nur ein humanitärer Schock, sondern auch eine wahre Fundgrube an Informationen. Sanitätsoffiziere, psychologische Kriegsführungseinheiten und Besatzungsbeamte dokumentierten umgehend ihre Erkenntnisse. Ihre Sprache war klinisch, fast steril – ein scharfer Kontrast zum Leid der Frauen, das sie festhalten wollten. In einem Bericht aus Manila Ende 1945 vermerkten Sanitäter der Armee, dass etwa 75 % der untersuchten Frauen Anzeichen von Geschlechtskrankheiten, Unterernährung oder chronischen Infektionen aufwiesen.
Ein weiteres Dokument verzeichnete durchschnittliche Körpergewichte von nur 36 kg, wobei mehrere Frauen Anzeichen von Anämie und Vitaminmangel aufwiesen. Ein Einsatzleiter schrieb unverblümt: „Diese Mädchen wurden bis zur Erschöpfung ausgebeutet.“ Zahlen stapelten sich auf den Seiten: Größe, Gewicht, Puls, Infektionen, abgebrochene Schwangerschaften. Im kalten Licht des Untersuchungszeltes wurden Menschen erneut zu bloßen Zahlen degradiert. Der Widerspruch war frappierend.
Jahrelang führten japanische Offiziere Buch über die Anzahl der Patienten pro Tag. Nun erstellten amerikanische Mediziner Tabellen, in denen sie die Verletzungen pro Fall oder den benötigten Kalorienbedarf dokumentierten. Beide Systeme machten aus Körpern Daten, wobei das eine auf Ausbeutung und das andere auf Heilung abzielte.
Dennoch berichteten Überlebende später, wie distanziert selbst Mitgefühl wirkte, wenn es nur durch Klemmbretter vermittelt wurde. „Sie haben uns wie Vieh vermessen“, erinnerte sich eine Koreanerin in einer Aussage aus den 1990er-Jahren. „Aber wenigstens ging die Messung diesmal mit Medizin einher.“ „Sinneserinnerungen verstärkten den Kontrast. Überlebende beschrieben das Brennen von Jod auf offenen Wunden, den metallischen Geschmack von Chinintabletten in ihren Handflächen, das kalte Gefühl von Thermometern unter ihrer Zunge.“
Manche weinten nicht vor Schmerz, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass jemand heilen und nicht kontrollieren wollte. Eine Krankenschwester der Armee schrieb später in ihr Tagebuch: „Sie hatten vergessen, wie sich Zärtlichkeit anfühlte. Selbst ein Verband wurde mit Misstrauen betrachtet.“ Auch psychologische Kriegsführungsteams sammelten Zeugenaussagen.
Sie befragten Frauen zur Moral, den Bewegungen und dem Verhalten japanischer Soldaten, in der Hoffnung, aus deren Traumata strategische Erkenntnisse zu gewinnen. In einem freigegebenen Protokoll beschrieb eine philippinische Gefangene, wie die Soldaten mit schwindenden Vorräten im Jahr 1945 immer verzweifelter und gewalttätiger wurden. Ein anderes koreanisches Mädchen sagte den Vernehmern: „Sie sagten: ‚Wir dienten dem Kaiser, aber sie dienten sich selbst.‘“ Solche Aussagen bestärkten die alliierte Propaganda, die das japanische Militär als brutal und unehrenhaft darstellte.
Für die Frauen bedeutete das Erzählen ihrer Geschichten jedoch, die traumatischen Erlebnisse, die sie am liebsten vergessen wollten, erneut zu durchleben. Die Zahlen stiegen rasant. Geheimdienste der Alliierten schätzten, dass zwischen 50.000 und 200.000 Frauen in ganz Asien diesem System unterworfen waren.
Manche Wissenschaftler schätzten die Zahl höher ein, doch die gezielte Vernichtung von Aufzeichnungen machte Gewissheit unmöglich. 1946 berichteten Besatzungsbeamte in Japan, dass ganze Dörfer in Korea und Taiwan ihrer jungen Frauen beraubt worden waren. Das Ausmaß war kontinental. Der Widerspruch verschärfte sich erneut. Die Befreiung brachte Medizin, Nahrung und Aufmerksamkeit. Doch sie brachte auch neue Formen der Objektifizierung der amerikanischen Armee mit sich.
Die Frauen waren sowohl Opfer, die geheilt werden mussten, als auch Beweismittel, die katalogisiert werden mussten. Mitgefühl war vorhanden, aber bürokratisiert. „Endlich waren wir frei“, sagte eine Überlebende. Doch auch die Freiheit war mit Formularen verbunden. Trotzdem war der Unterschied unbestreitbar.
Zum ersten Mal seit Jahren wurden Nadeln zur Impfung und nicht zur Bestrafung eingesetzt. Pillen wurden zur Heilung und nicht zur Geburtenkontrolle verabreicht. Aufzeichnungen dienten der Wiederherstellung der Gesundheit und nicht der Ausbeutung. Dieselben Werkzeuge, Stifte, Akten und Krankenakten, die einst ihre Menschlichkeit ausgelöscht hatten, begannen nun unvollkommen, sie wiederherzustellen.
Doch die eindrücklichsten Erinnerungen an die Befreiung fanden sich nicht in Berichten oder Archiven. Sie lebten in den kleinsten Gesten. Der Soldat, der einen Sandalenriemen band. Der Sanitäter, der ein sauberes Tuch reichte. Die Krankenschwester, die nur kurz verweilte, um leise zu fragen: „Geht es Ihnen gut?“ Diese zarten Gesten der Barmherzigkeit begannen, etwas Größeres als Gesundheit wiederherzustellen. Sie begannen, Vertrauen wiederherzustellen.
Das Vertrauen kam jedoch nicht über Nacht. Es entwickelte sich nur zögerlich, in Bruchstücken, getragen von so kleinen Gesten, dass sie in jedem anderen Kontext unbemerkt geblieben wären. Überlebende erinnerten sich später daran, wie sich selbst die alltäglichsten Handlungen nach Jahren im System des Zwangs außergewöhnlich anfühlten. Eine junge Frau erzählte, wie ihr ein Stück Seife geschenkt wurde.
Sie drehte es immer wieder in den Händen, halb in der Erwartung, dass er es ihr wieder wegnehmen würde. Der Soldat, der es ihr angeboten hatte, wandte sich danach nicht mehr ihr zu. Er ging einfach weiter. „Es war das erste Geschenk, das ich je erhalten hatte, für das nicht mein Körper verlangt wurde“, erinnerte sie sich.
Ein anderer erinnerte sich, wie ein amerikanischer Soldat winzige Vögel aus Altholz schnitzte und sie wortlos neben die Hüttentür legte. „Die kleinen, groben und unebenen Figuren strahlten mehr Zärtlichkeit aus als jahrelange erzwungene Aufmerksamkeit. Auch das Essen wurde zu einer eigenen Sprache. Die herbe Süße von Dosenpfirsichen, die schwere Wärme von dick mit Butter bestrichenem Brot. Diese Geschmäcker durchdrangen die Angst.“
Frauen berichteten, wie sie schweigend da saßen, Dosen umklammernd, anfangs zu überwältigt, um zu essen. Langsam wurde das Schlucken für sie zum Akt der Rückgewinnung des Lebens. Es war, als ob man die Freiheit schmeckte, sagte eine philippinische Überlebende Jahrzehnte später. Doch Misstrauen blieb bestehen. Manche Frauen zuckten zusammen, wenn man sich ihnen näherte, aus Angst vor Befehlen oder Gewalt, andere schreckten vor medizinischen Untersuchungen zurück, aus Furcht vor einer weiteren Eintragung in die Quotenliste.
Doch als aus Tagen Wochen wurden, überwog die Güte allmählich die Reflexe des Schreckens. Verbände wurden ohne Befehl angelegt, Wunden ohne Aufforderung gereinigt. Eine Krankenschwester schrieb später in ihr Tagebuch, dass sie kaum mehr tun konnte, als schweigend neben den Frauen zu sitzen und mit ihrer Anwesenheit zu beweisen, dass nicht jede Uniform Grausamkeit verbarg. Zarte Freundschaften entstanden.
Einige Überlebende begannen leise zu lachen, als wollten sie testen, ob die Welt sie für ihre Freude bestrafen würde. Eine Mundharmonikamelodie erklang. In der Abenddämmerung entlockte ein Soldat, der ein fast vergessenes Volkslied spielte, schüchterne Lächeln. Ein Mädchen fuhr die Melodie mit dem Finger in der Luft nach, unfähig zu sprechen, aber auch nicht bereit, sie unbemerkt vorübergehen zu lassen.
Diese kleinen Gesten der Gnade knüpften etwas Wesentliches zusammen: Selbstbestimmung. Jahrelang waren ihr die Entscheidungen genommen worden – wann sie essen, wann sie schlafen, wann sie ausharren sollten. Nun wurde selbst die Entscheidung, eine Ration abzulehnen oder einen geschnitzten Vogel zu behalten, zu einem Akt der Selbstbestimmung. Eine Überlebende schrieb später in ihrer Aussage: „Zum ersten Mal erinnerte ich mich daran, dass ich einen Namen hatte. Doch der Widerspruch blieb bestehen.“
Dankbarkeit und Misstrauen bestanden nebeneinander. Manche Überlebende konnten die amerikanischen Soldaten trotz ihrer sanfteren Methoden nie anders als eine weitere Besatzungsmacht sehen. Andere klammerten sich verzweifelt an die Gesten, im Glauben, dass selbst im Krieg Menschlichkeit zum Vorschein kommen konnte. Was sie einte, war das Bewusstsein, dass Heilung nicht sofort eintreten würde.
Es war ein Prozess, der sich nicht in Diagrammen oder Kalorien bemessen ließ, sondern in Momenten der Würde, die in jenen Hütten und Feldlazaretten zurückkehrten. Barmherzigkeit konnte das Geschehene nicht ungeschehen machen. Nichts konnte das. Aber sie pflanzte die Hoffnung auf eine Zukunft jenseits des bloßen Überlebens. Für die Frauen war es keine Rettungsgeschichte, die in fetten Schlagzeilen geschrieben stand, sondern ein zerbrechlicher Anfang, getragen von Seife, Pfirsichen, Holzfiguren und der Erinnerung an Musik, die in die Nacht hineinklang. Als der Krieg endete, folgte die Stille wie ein Schatten.
Für die Frauen, die einst als Trostmädchen bezeichnet wurden, brachte die Befreiung keine sofortige Anerkennung. Ihr Leid blieb in den großen Erzählungen von Sieg und Wiederaufbau weitgehend unsichtbar. Das 1946 einberufene Tokioter Kriegsverbrechertribunal dokumentierte Massaker, Chemieexperimente und Zwangsarbeit mit klinischer Präzision.
Doch das System der Zwangsprostitution, ein riesiges und akribisch organisiertes, fand kaum Beachtung. Es war, als wären die Aufzeichnungen, die einst Quoten festlegten, zusammen mit den Beweisen verbrannt worden. Die Statistiken waren für jeden einsehbar. Historiker schätzen, dass zwischen 50.000 und 200.000 Frauen in ganz Asien in Japans Militärbordellsystem gezwungen wurden.
Register belegten, dass Züge voller Frauen aus Korea, den Philippinen, China und Burma verschleppt wurden. Ärzte führten Berichte über Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaftsabbrüche. Doch in den Gerichtsakten tauchte der Begriff „Troststation“ nur selten auf. Die Justiz hatte ihre eigenen Verbrechenskategorien festgelegt, und sexuelle Sklaverei passte nicht ohne Weiteres in die 1946 gezogenen Kategorien. Viele Überlebende versuchten, die Vergangenheit zu verdrängen, gezwungen durch das Stigma zum Schweigen.
In Korea wurden zurückkehrende Töchter oft von ihren Familien verstoßen. Auf den Philippinen heirateten Frauen heimlich und erzählten niemandem davon. Scham war eine ebenso mächtige Waffe wie das Bajonett. Eine koreanische Überlebende gab später zu: „Ich habe es nicht einmal meinen Kindern erzählt. Ich lebte wie ein Geist in meinem eigenen Haus. Doch Schweigen ist nie vollständig.“ 1991, fast ein halbes Jahrhundert später, drangen die ersten Zeugenaussagen an die Öffentlichkeit.
Kim Haksun, eine koreanische Überlebende, trat vor Kameras und erklärte, sie sei mit 17 Jahren verschleppt und in ein Militärbordell gezwungen worden. Ihre Worte lösten weltweit ein Umdenken aus. Andere folgten. Philippinische Großmütter traten vor Mikrofone, ihre Stimmen zitterten, aber sie waren eindringlich. Chinesische Überlebende klagten vor internationalen Gerichten. Die Last jahrzehntelanger Gräueltaten brach sich Bahn brach.
Die Regierungen reagierten unterschiedlich. 1993 veröffentlichte Japan die Kono-Erklärung, in der die Beteiligung des Militärs an der Errichtung und dem Betrieb von Troststationen anerkannt wurde. Die Formulierung war jedoch vorsichtig und zurückhaltend, sodass spätere Regierungen sie dementieren konnten. Finanzielle Entschädigungen wie der Asiatische Frauenfonds von 1995 wurden als Wiedergutmachung angeboten, doch viele Überlebende lehnten sie ab und forderten rechtliche Verantwortung statt Wohltätigkeit.
Das Paradoxon wiederholte sich: Anerkennung ohne vollständige Akzeptanz, Entschuldigung ohne Abschluss. Der Erinnerungskrieg wurde immer erbitterter. Nationalisten in Japan wiesen Zeugenaussagen als Fälschungen zurück, während in Seoul und Manila Bürgergruppen Statuen und Denkmäler errichteten. 2011 wurde gegenüber der japanischen Botschaft in Seoul eine Bronzestatue eines Mädchens im Hanbok aufgestellt.
Ihr leerer Stuhl neben ihr, wartend auf abwesende Zeugen. Seitdem versammeln sich dort jeden Mittwoch Demonstranten, um Gerechtigkeit für diejenigen zu fordern, deren Stimmen 1946 ungehört blieben. Für die Überlebenden selbst war die Erinnerung ein zweischneidiges Schwert. Sprechen bedeutete, das Erlebte wiederzuerleben, doch Schweigen bedeutete Auslöschung. Manche sagten einmal aus und zogen sich dann in die Einsamkeit zurück.
Andere bereisten die Welt, fest entschlossen, ihre letzten Jahre nicht im Verborgenen zu verbringen. Eine philippinische Überlebende, Lola Rosa, sagte 1996 vor Publikum: „Wir sind nicht nur Geschichte. Wir sind noch da. Wir atmen noch, und wir wollen, dass die Welt es weiß.“ Die Prüfungen waren an ihnen vorbeigezogen, doch die Erinnerung, einmal freigelegt, würde nicht wieder verblassen. Was in Hütten und Büchern verborgen gewesen war, wurde nun Gegenstand des öffentlichen Gewissens. Doch dies war nur der Auftakt zu einer umfassenderen Frage.
Wie würden Nationen und die Geschichte selbst sich erinnern? Was einst nur hinter vorgehaltener Hand besprochen worden war, wurde bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in Stein, Bronze und Papier eingraviert. Das System der Trostfrauen war nicht länger eine vergessene Fußnote. Es war zu einem umstrittenen Erinnerungsstück geworden, das die Beziehungen der Nationen prägte. In Seoul, Manila, San Francisco und Berlin entstanden Denkmäler. Auf jedem saß die Gestalt einer jungen Frau schweigend da, ihr Blick fest, der Stuhl neben ihr leer – eine Forderung nach Erinnerung, nicht nach Mitleid.
Doch jede Statue rief Proteste aus Tokio hervor, wo die Behörden beteuerten, die Vergangenheit sei aufgearbeitet, die Entschuldigungen ausreichend, die Angelegenheit abgeschlossen. Dieser Widerspruch prägte die Zukunft. Die Überlebenden waren jahrzehntelang zum Schweigen gebracht worden, nur um ihnen nicht geglaubt zu werden, als sie endlich sprachen. Regierungen stritten über Verträge und Abkommen, während die Frauen auf etwas Einfacheres und Tiefgründigeres bestanden.
Anerkennung. Zahlen spielten eine Rolle. Ob es nun die von konservativen Wissenschaftlern geschätzten 50.000 oder die von Aktivisten genannten 200.000 waren – die eigentliche Wahrheit lag nicht in Statistiken, sondern in den einzelnen Stimmen. Jedes Zeugnis trug dazu bei, den Mythos zu entkräften, die Vergangenheit ließe sich begraben. Und doch blieb ein weiterer Gegensatz bestehen.
Viele Amerikaner, die 1945 Überlebende trafen, trugen Erinnerungen nicht an Eroberung, sondern an Unterdrückung in sich. Ein Militärarzt beschrieb Jahre später den Widerspruch in seinem Tagebuch: „Uns wurde beigebracht, dass die Japaner diese Frauen wie Lebensmittelrationen behandelten – entbehrlich und ersetzbar. Für uns waren sie einfach nur Menschen, die Fürsorge brauchten. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, sie zu berühren, weil sie befürchteten, wir würden es tun.“
Es war ein kleines Gedenken, das jedoch das übergeordnete Thema widerspiegelte. Manchmal konnte Barmherzigkeit selbst die Dynamik des Krieges umkehren. Von Hütten bis zu Krankenhäusern, von Tribunalen bis zu Statuen – die Geschichte entfaltete sich in unterschiedlichsten Dimensionen. Sie begann mit Bambuswänden, die in der Nacht erzitterten, und endete mit diplomatischen Depeschen, die in den Hauptstädten ausgetauscht wurden.
Die Frauen, die einst beim Geräusch der Stiefel in Yaoong zusammenzuckten, erlebten noch, wie ihre Namen auf Gedenktafeln eingraviert wurden. Ihre Zeugnisse wurden archiviert, ihre Würde in den Straßen fremder Städte verteidigt. Sie waren als Gefangene gekommen, ihre Identität auf Nummern reduziert. Sie erlebten, wie sie als Zeuginnen wiederhergestellt wurden. Man hatte ihnen gesagt, es würde niemanden interessieren. Doch Jahrzehnte später studierten Studenten ihre Worte, Journalisten schrieben ihre Namen, und Fremde weinten vor ihren Statuen.
In einem Krieg, der für Bomben und Schlachtschiffe in Erinnerung blieb, war die bleibende Waffe nicht die Zerstörung, sondern das Zeugnis. „Sie kamen als Eroberer“, schrieb ein Historiker über die japanische Armee. „Aber sie gingen als Lernende, ihr Imperium zerschlagen, ihre Mythen entlarvt.“ Und die Amerikaner, deren Schweigen und Distanz die Überlebenden 1945 so schockierten, hinterließen keine Besitzansprüche, sondern eine paradoxe Erinnerung: dass inmitten des totalen Krieges Zurückhaltung ihre eigene Kraft entfalten konnte.
Letztendlich waren Amerikas größte Waffen nicht seine Bomben, sondern sein Überfluss, die Fähigkeit, Seife statt Ketten, Pfirsiche statt Befehle, Schweigen statt Anweisung anzubieten. Für die Frauen, die die finstersten Schrecken des Krieges erdulden mussten, waren diese kleinen Gnaden der Beweis, dass selbst nach Jahren systematischer Grausamkeit die Menschlichkeit nicht gänzlich erloschen war.
Die Geschichte der japanischen Trostmädchen und ihrer Begegnung mit amerikanischen Soldaten ist keine einfache Geschichte von Bösewichten und Rettern. Es ist eine Erzählung voller Widersprüche, von einem System, das Frauen auf bloße Aktenzeichen reduzierte, und von Fremden, die ihnen Bruchstücke ihrer Würde zurückgaben. Es ist die Geschichte eines Schweigens, das Jahrzehnte zu spät gebrochen wurde, von Erinnerung, die politisch instrumentalisiert wurde, und von Überlebenden, die forderten, als mehr als nur Geschichte wahrgenommen zu werden.
Vor allem erinnert es daran, dass selbst in den brutalsten Kriegsschauplätzen die kleinsten Akte der Menschlichkeit, eine Gabe von Nahrungsmitteln, die Weigerung, Ausbeutung zu betreiben, die Anerkennung eines Namens, länger nachhallen können als der Donner der Gewehre.



